Frau Merz-Solliec ist Musiktherapeutin (M.A.) und hat eine eigene Praxis für Musiktherapie und Hörtherapie in Karlsruhe. Sie bietet Musiktherapie mit Frühgeborenen im Klinikum Mittelbaden (Baden-Baden), im Olgahospital in Stuttgart und Städtischen Klinikum in Karlsruhe an. AKIK durfte Sie zu Ihrer Arbeit und Erlebnissen interviewen.

AKIK: Frau Merz-Solliec, wie kamen sie dazu Musiktherapie auch auf neonatologischen Stationen anzubieten?
Frau Merz-Solliec: Vor ca. 5 Jahren bekam ich die Gelegenheit, das musiktherapeutische Angebot auf der neonatologischen Intensivstation am Stuttgarter Olgahospital zu übernehmen. Da musste ich nicht viel nachdenken, denn in die Arbeit mit den Frühgeborenen und kranken Neugeborenen konnte ich meine bisherigen Erfahrungen wunderbar einfließen lassen.
Ich hatte als Musiktherapeutin bis dahin mit Kindern mit (teils komplexen) Behinderungen und chronischen Erkrankungen gearbeitet, auch mit ehemaligen Frühgeborenen, habe Elternkind-Singgruppen angeleitet. Zudem war ich als Referentin, u.a. für das Jugendamt, zu den Themenbereichen „Hören“ und „Frühkindliche musikalische Bildung“ aktiv, gab in Elternveranstaltungen, Babygruppen etc. praktische Tipps und Anregungen.
Vor zwei Jahren durfte ich dann am Klinikum Mittelbaden in Baden-Baden noch die Musiktherapie als neues Angebot auf der Kinderintensivstation/Neonatologie aufbauen.
AKIK: Wie verläuft eine Sitzung mit Ihnen/ Wie sieht eine Behandlung bei Neu- und Frühgeborenen aus?
Frau Merz-Solliec: Nach einem gegenseitigen Kennenlernen begleite ich die Eltern idealerweise beim Kuscheln bzw. Känguruhn mit ihrem Baby, meistens mit einem Instrument namens „Monochord“. Das ist ein Saiteninstrument mit einem stimmungsvollen, sanften Klang und leicht spürbaren Vibrationen. Dessen Klangteppich bietet eine wunderbare Basis, um dazu zu Summen und mit der Stimme zu Improvisieren. Wenn die Eltern mal nicht da sein können, nehme ich das Kind aber auch allein zu mir auf den Arm oder ich spiele bzw. summe während es im Inkubator liegt (durch eine geöffnete Klappe).
Zum Einstieg nutze ich gerne auch Atemübungen, die das spätere Summen erleichtern. Der rein musikalische Teil kann zwischen 15 und 30 Minuten dauern, in der Regel rundet ein Gespräch die Sitzung ab. Nicht selten passiert es, dass die Eltern sich mir nach der Musik öffnen. Wenn es Richtung Entlassung geht, freuen sich die Eltern dann aber auch über musikalische Spielideen und Impulse für zu Hause.
AKIK: Welchen Effekt erleben Sie bei den Kindern und Eltern durch ihre Therapie?
Frau Merz-Solliec: Die Eltern empfinden die Sitzungen häufig als „erdend“ und entspannend. Zudem genießen sie die veränderte Atmosphäre auf der Intensivstation; so kann die 1-2 x pro Woche stattfindende Musiktherapie durchaus auch zu einem richtigen „Highlight“ werden, welches den medizinischen Krankhausalltag bereichert und auflockert.
Die Babys reagieren ebenfalls oft mit Entspannung. Häufig sinken während der Musiktherapie die Atem- und Herzfrequenz, was auch die Sauerstoffsättigung begünstigen kann. Daneben beobachte ich, dass die Musik zum Kuscheln und Streicheln einlädt, dass Berührungsängste liebevollen Gesten weichen. Das ist wirklich schön zu sehen.
AKIK: Warum wirkt Musik aus Ihrer Sicht heilend auf Körper und Seele?
Frau Merz-Solliec: Musik macht etwas mit uns; sie berührt unseren Körper und unsere Seele auf ganz besondere Weise. Darin liegt für mich die „heilende“ Kraft. Mit Ihrer Hilfe können wir uns (besser) spüren, uns mit uns verbinden. Das ist unglaublich wichtig, besonders in schwierigen Zeiten. Darüber hinaus können die entstehenden musikalischen Dialoge, sowie das gemeinsame Spielen und Singen einen bedeutsamen (psycho-) therapeutischen Wert haben. Über die teils vielen Wochen bzw. Monate auf Station entstehen auch in der Musiktherapie intensive Beziehungen, die den Eltern Halt und Kraft geben; was auch die Bindung mit ihrem eigenen Kind erleichtert.
AKIK: Die Musiktherapie kann die Bindung zwischen Eltern und Kind also enorm stärken. Wie wichtig grundsätzlich eine Bezugsperson für kranke Kinder ist, hat AKIK bereits 1988 in der EACH-Charta formuliert, die in 10 Artikeln die Rechte von kranken Kindern und Jugendlichen im Krankenhaus definiert und ein Grundpfeiler unserer Arbeit ist. Welchen Artikel der EACH-Charta empfinden Sie als besonders wichtig in Zusammenhang mit Ihrer Arbeit und den damit verbundenen Erlebnissen?
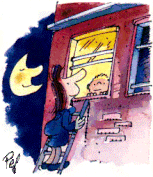
Frau Merz-Solliec: Auf jeden Fall Artikel 2 „Kinder im Krankenhaus haben das Recht, ihre Eltern oder eine andere Bezugsperson jederzeit bei sich zu haben“.
Nähe und Sicherheit im Krankenhaus, die durch eine Bezugsperson vermittelt wird, ist unerlässlich für die Entwicklung und Genesung. Die Kleinen brauchen körperliche Nähe für das intensive Bonding und das in einer angemessenen Umgebung.
Darum ist auch Artikel 7 „Unterstützung nach Alter und Entwicklungsstand“ für mich bedeutend. Hierzu zählt für mich auch, eine angemessene auditive Umgebung und Stimulierung, die die Kinder nicht überreizt.

AKIK: Macht es denn einen Unterschied, ob Eltern mit ihrem Kind sprechen oder singen, um die Bindung zu stärken?
Frau Merz-Solliec: Ja, auf jeden Fall. Beim Singen sind wir viel präsenter und fokussierter, auch die Aufmerksamkeit der Kinder ist wesentlich höher. Manchmal öffnen die Babys schon beim ersten Ton ihre Augen. Ein Baby, das auf der Brust von Mutter oder Vater liegt, während gesungen / gesummt wird, nimmt auch die Vibrationen intensiv wahr. Das schafft eine intensive Verbindung. Das Kind erlebt sich im Prinzip selbst dadurch als Teil des Klangs; ein bisschen so wie es während der Schwangerschaft war. Die Eltern bestätigen mir regelmäßig, dass das entspannte Singen / Summen für sie eine besondere Verbindung zum Kind ist und die Bindung stärkt.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass Musiktherapie nicht unbedingt auf Sprache angewiesen ist, wodurch auch Eltern erreicht werden, die nicht reden möchten oder große Sprachbarrieren haben. Das macht die Musiktherapie meiner Meinung nach zu einer wichtigen Ergänzung des psychosozialen Angebots auf Station.

AKIK: Wie finanziert sich ihre Therapie?
Frau Merz-Solliec: Meine Arbeit wird komplett über Spenden finanziert. Am Klinikum Mittelbaden in Baden-Baden stellt der Verein BaBaKi e.V. die Mittel zur Verfügung, im Olgahospital in Stuttgart ist es die Olgälestiftung für das kranke Kind. Weitere Unterstützung durch Spenden, wie sie dieses Jahr bereits vom AKIK-Landesverband Baden-Württemberg. e.V. getätigt wurde, unterstützen das Projekt zusätzlich.
Weiter Informationen zu der Arbeit von Frau Merz-Solliec:
